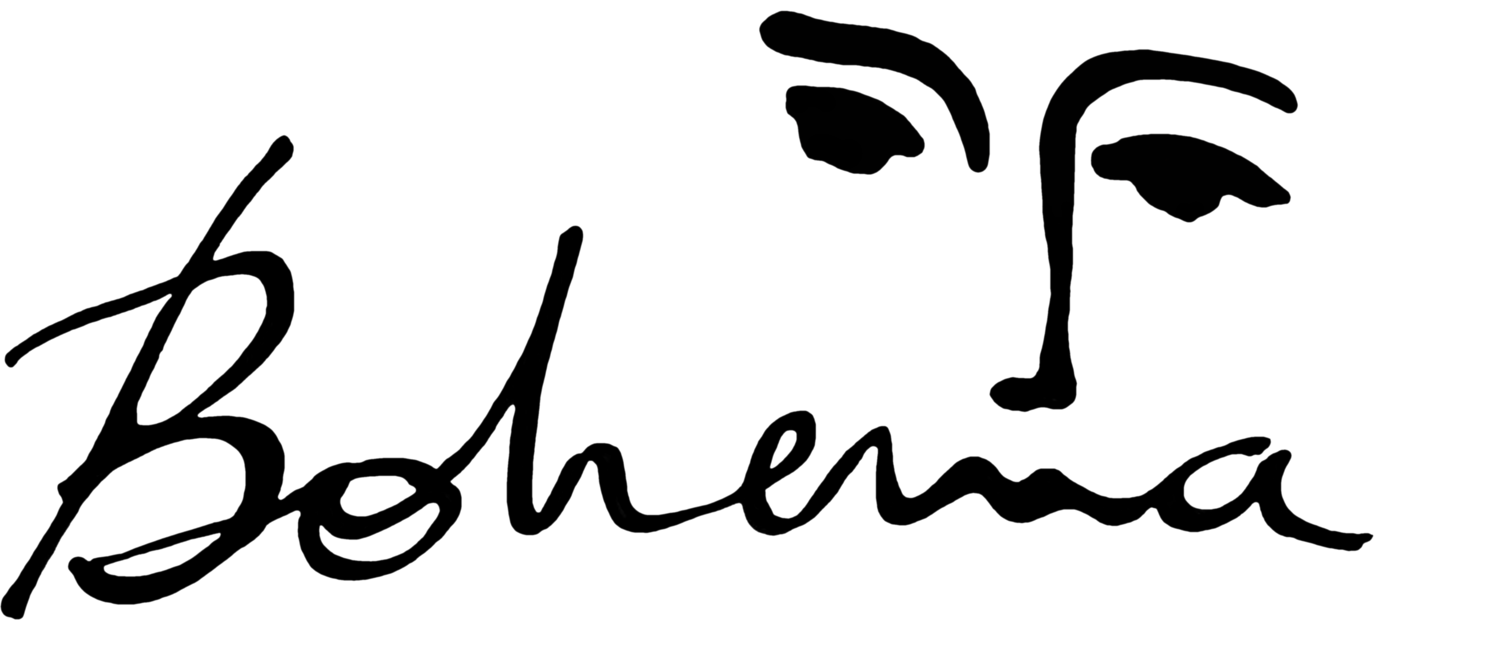Veronica Kaup-Hasler: The Godmother of Culture
Fotzenschleimpower bei den Festwochen, Nitsch im Ikea und Voges bald in Köln: Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler über Babler als Kulturminister, die Z-Wort-Debatte beim Strauss-Jahr und ihre Zukunft nach der Wahl.
Eine Version dieses Artikels ist zunächst in der ‘Presse’ erschienen.
Bohema In Berlin wurde das Kulturetat stark gekürzt. Steht uns das auch bevor?
Veronica Kaup-Hasler: Nach der Wahl wird erst einmal das Budget verhandelt – und da werde ich mich für die Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und das Publikum engagieren, wie ich es bisher auch getan habe. Und wir würden mit der Situation nicht so umgehen, wie es in Berlin passiert ist. Wir müssen klug agieren und Synergien finden, um Ressourcen und Personal vielfältiger nutzen zu können.
Ist der Abgang von Kay Voges vom Volkstheater sein Scheitern oder ein Verlust, den Sie nicht verhindern konnten?
Das ist für mich eindeutig ein Verlust. Er hatte einen schwierigen Auftakt in der Coronazeit und hat das Haus trotzdem schnell auf die internationale Theaterlandkarte gesetzt, auch ein junges Publikum erreicht. Das besser dotierte Kölner Schauspielhaus hat seinen Erfolg gesehen und zugeschlagen, als Stefan Bachmann von dort ans Burgtheater kam. Das Match ist 1:1 ausgegangen, würde ich sagen (lacht).
Wie ist ihre aktuelle Beziehung zur SPÖ?
Ich bin nach wie vor kein Mitglied. Unser Herr Bürgermeister gibt mir freie Hand als Ermöglicherin für Kultur in der Stadt. Ich kämpfe gern für diese Stadtregierung und werde die SPÖ wählen. Nicht, weil ich für sie arbeite, sondern weil ich ihr Wirken für ein funktionales soziales Miteinander überaus schätze.
Ihrem neuen Bundespendant Andreas Babler wurde fehlendes Fachwissen in der Kultur vorgeworfen.
Ich finde, das ist ein unfairer Vorwurf: Vor mir gab es auch niemanden in dieser Position, der aus der Kultur kam. Da bin ich ein „seltsames Tier in diesem Zoo“. Entscheidend ist, dass er versteht, dass er das Wissen der Vielen braucht. Auch ich brauche die Expertise aus dem Feld. Wir saßen schon am Montag nach seiner Angelobung zusammen, ich habe ihm geraten, viel in den Austausch zu gehen und in der Kultur präsent zu sein. Für die Szene ist das sehr wichtig.
Ihr Lebenspartner Claus Philipp hatte eine leitende Rolle in der ersten Ausgabe der Festwochen. Ist das Freunderlwirtschaft?
Claus Philipp ist ein wichtiger Kulturschaffender dieser Stadt, schon die Verbindung zwischen Christoph Schlingensief und Elfriede Jelinek kam über ihn zustande. Er war es, der bei Elfriede Jelinek bewirkt hat, dass sie die Aufführung von „Burgtheater“ zulässt und er arbeitet nun als Dramaturg bei dieser Produktion. Im Übrigen ist er nicht bei den Wiener Festwochen angestellt. Die Entscheidung zur künstlerischen Zusammenarbeit ging und geht immer von den Kunstschaffenden – in diesem Fall eben Milo Rau – aus.
Die FPÖ hat sich besonders über das Stück „Fotzenschleimpower gegen Raubtierkapitalismus“ aufgeregt. Sehen Sie eine Gefahr, dass eine ‚linke Kulturbubble‘ die Gesellschaft weiter polarisiert?
Wir müssen immer wieder selbstkritisch schauen, wo Exklusionen auftreten, obwohl wir von Inklusion reden. Wir dürfen aber auch nicht die Slogans der FPÖ unhinterfragt durch Wiederholung bestätigen. Ich sehe keine hermetisch abgeschlossene Kunstbubble. Und die bürgerliche Reaktion auf Fäkalsprache und Sexualität gab es immer schon. Unsere Gesellschaft wird zum Glück immer offener. Mittlerweile freut sich ja auch jeder Bankdirektor, einen Nitsch zu haben – und Reproduktionen seiner Arbeit werden vielleicht auch irgendwann bei IKEA zu kaufen sein. Gleichzeitig empören uns die wirklichen Skandale kaum. Dass Frauen immer noch weniger verdienen, dafür geht kaum jemand auf die Straße. Ich habe das Stück leider noch nicht gesehen, aber nur Gutes gehört. Es gilt für mich das Gleiche wie etwa bei der Künstlerin Florentina Holzinger: Erzeugt der Skandal einen Mehrwert oder ist das nur ein künstlerischer Stinkefinger?
Sind sie zufrieden, wie die Prozesse nach den Missbrauchsvorwürfen beim Theater der Jugend und in der Josefstadt gelaufen sind?
Auch wenn diese beiden Theater in ihrer Organisationsform mir nicht direkt zugeordnet sind, war es mir wichtig, dass schnell reagiert wird. Gleichzeitig muss man feststellen, dass es sich um jeweils komplexe Prozesse gehandelt hat, da verschiedene Akteur*innen und Ebenen involviert waren: die jeweilige Institution sowie die beiden Fördergeberinnen (Bund und Stadt – beim Theater der Jugend gibt es mit dem Land Burgendland sogar noch einen dritten Fördergeber). Für mich ist klar: Wir verfolgen die Entwicklungen in unseren Institutionen sehr genau – denn eine faire und respektvolle Arbeitskultur ist das, was wir wollen!
Mit dem Geldhahn können Sie trotzdem Druck ausüben.
Förderungen, die sich an Institutionen richten, und Fehlverhalten von Führungskräften sind zwei unterschiedliche Sachverhalte – es ist nicht zielführend, einer Institution Geld zu entziehen, wenn man mit einzelnen Personen oder deren Handlungen nicht einverstanden ist. Damit beschädigt man die gesamte Institution und deren Mitarbeiter*innen.
Das Budget des Strauss-Jahres hat auch Unverständnis ausgelöst. Woher kam das Geld?
Diese 22 Millionen kamen extra zum Kulturbudget dazu - es ist somit eine zusätzliche Investition in die Kultur. Im Verhältnis hat das Mozart-Jahr 2006 45 Millionen gekostet. Anlässlich des Jubiläums bringt die Stadt den Künstler mit einem sehr üppigen Programm, das der gesamten Kulturlandschaft Wiens zugutekommt, ins Heute.
Wobei das Programm in der Kritik bisher ziemlich schlecht wegkam.
Die Silvesternacht mit Martin Grubinger fand ich toll, alles konnte ich auch nicht sehen. Gerade war ich in „Das Lied vom Rand der Welt“, das fand ich mutig. Und dass ein Programm, das Experimente wagt, unterschiedliche Reaktionen auslöst, ist ja auch klar.
Das Stück wurde von der Hochschüler:innenschaft österreichischer Roma und Romnja kritisiert, tatsächlich wurde mit dem Z-Wort im Untertitel die Stadt vollplakatiert. Ist das in Ordnung?
Offensichtlich reichen die Anführungszeichen nicht, um die kritische Auseinandersetzung zu zeigen. Das tut mir leid für das Stück selbst, das genau dieses Thema sehr bewusst aufgearbeitet hat.
Die Wahl ist zumindest eine Zäsur für Ihr Amt, worauf sind Sie stolz, wenn Sie zurückschauen?
Ich glaube, dass es mir gelungen ist, der Kultur in der Stadtregierung einen wesentlich größeren Stellenwert zu geben, finanziell und ideell. Stolz bin ich zum Beispiel auf die kulturellen Ankerzentren außerhalb der Innenstadt. Oder darauf, dass die Dauerausstellung des Wien Museums jetzt kostenfrei ist. Das war nach all den Investitionen auch riskant, aber erfolgreich: Es gibt mehr als fünfmal so viele Besucher*innen wie zuvor, durch den Mehrverkehr wird insgesamt nicht weniger Geld eingenommen. Stolz bin ich auch auf unsere Raumoffensive, zum Beispiel auf das sich in Planung befindliche Atelierhaus im Otto-Wagner-Areal mit etwa 100 neuen Ateliers. Auch der Kultursommer macht mich glücklich. Er entstand im ersten Lockdownsommer spontan als Coronamaßnahme, auch zur Unterstützung der Künstler*innen. Als uns klar wurde, dass 40% des Publikums zuvor überhaupt keine Berührung mit Live-Kultur hatte und dass im Publikum die Einkommensschwächsten stark vertreten waren, haben wir beschlossen, das Angebot fortzusetzen.
Beim Budget von vier Mio. € und 80.000 Besuchern zahlt die Stadt 50 € pro Besucher. Lohnt sich das?
Gerade in diesen Krisenzeiten müssen wir verstärkt Zugang zu Kultur ermöglichen. Kultur ist für mich ein Grundbedürfnis, sogar ein Menschenrecht. Der Kultursommer schafft zudem einen für die Demokratie wichtigen sozialen Raum.
Kritik kam auch von kleinen Veranstaltern, ihr Publikum würde wegbleiben.
Ich verstehe diese Sorge, aber ich glaube an eine gegenseitige Bereicherung. Die 40% des Kultursommer-Publikums ohne vorherigen Kontakt zur Kultur wären wohl auch sonst nirgendwo hingegangen. Und vielleicht bekommen manche gerade durch den Kultursommer Hunger auf mehr.
Würden Sie gerne weitermachen?
Wenn ich weiterhin gestalten darf, würde ich das gerne tun. Ich hatte Angebote, zurück in die Kultur zu gehen. Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten glaube ich in meiner Rolle als Kulturpolitikerin mit meiner Expertise, Erfahrung und Leidenschaft für die Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und das Publikum einen Unterschied machen zu können.