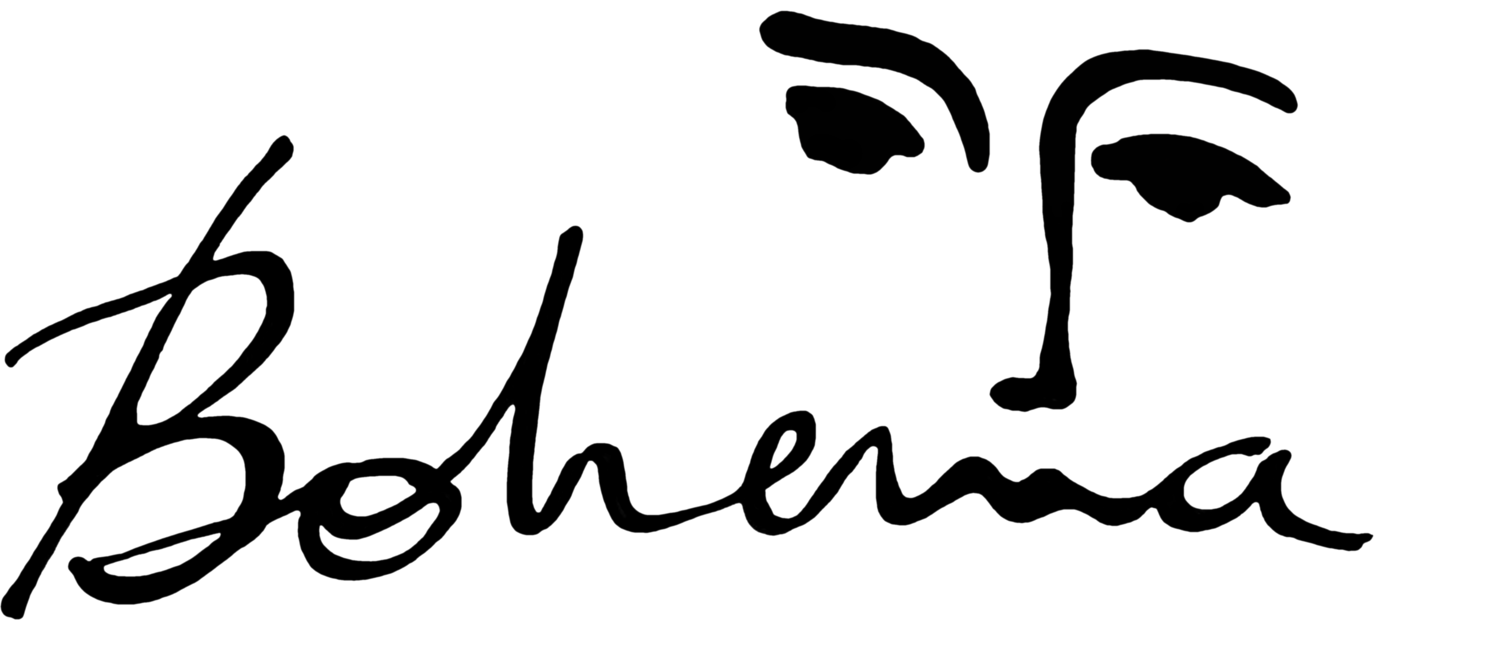80 leere Gesichter
Jonas Höschl: Was ist ein Portrait? Das Fotobuch 80 Portraits: 73 Männer, 7 Frauen erfüllt in einer Zeit, in der rechtsextreme Ideologien in Europa und weltweit wieder erstarken, eine dokumentarische und entlarvende Funktion.
Ansicht Buchcover “80 Portraits: 73 Männer, 7 Frauen” (Ausschnitt) /// © Hannes Rohrer
Am 14. März stellte der Konzeptkünstler und Fotograf Jonas Höschl (*1995) sein neues Buch 80 Portraits: 73 Männer, 7 Frauen im Softcover Buchladen vor. Die gebundene Ausgabe basiert auf einer Installation Höschls, in der die ausgewählten Portraits per Dia-Projektor, wie an einem gemütlichen Familienabend, an die Wand geworfen werden. Ein Fotoabzug der Installation ist durch das Cover hindurchgetackert im Buch zu finden.
Die Anzahl der 80 Portraits hat daher einen praktischen Ursprung - ein Dia-Projektor hat 80 Fächer. Die Fotos auf schwarzem Hintergrund, der die Projektion im schwarzen Raum abbildet, sind entgegen der Stimmung jedoch weniger gemütlich, sondern rechtsextrem, um genau zu sein. Das Setting erfährt eine gewalttätige Verlagerung und erzeugt eine darin geladene Spannung. Durch das Rattern des Projektors - klack, klack, klack…- sitzt die Bedrohung auch direkt im Ohr. Dafür wurde das digitale Material analogisiert, für das Buch auch, sozusagen - man denke an den Sound vom Umblättern der Seiten. Da gehe es hauptsächlich um die physische Präsenz, die die Gewalttätigkeit verdeutliche, so Höschl.
Die Fotos selbst stammen aus Archiven der antifaschistischen Dokumentationsarbeit, die in ihrer üblichen Form Protagonist*innen der Neonaziszene kartographieren und als Selbstschutz vor Angriffen und Beweismittel für die antifaschistischen Aktivist*innen dienen, wodurch der Handlungsspielraum der fotografierten Personen eingeschränkt werden soll. Genauso wie der Antifaschismus pflegt auch der Faschismus eine solche Kartei ihrer politischen Gegner*innen. Deshalb finden sich im Buch viele Portraits mit einer Kamera vor dem Gesicht. Es wird augenblicklich zurückgeschossen, ein mediales Duell wird ausgefochten - und worum geht es letztendlich? Um Macht. Diese Spiegelung visuell darzustellen gelingt Höschl, indem er die Portraits auf die „falsche“ Seite des Fotopapiers druckt und daneben die üblich bedruckte Seite des Fotopapiers in weißer Leere als Gegenpart stehen lässt. Demnach war das Kriterium für die exemplarische Auswahl, dass sich die Fotografierten über das Fotografieren bewusst sind, dass sie in die Kamera schauen und eben zum Gegen(schnapp)schuss ausholen. Das Geschlechterverhältnis wäre ungefähr exemplarisch, so der Künstler, es seien wohl mittlerweile insgesamt mehr Frauen in der Szene, diese sind aber noch immer stark unterrepräsentiert.
Künstler Jonas Höschl und Felix Hoffmann während der Buchpräsentation im Softcover Buchladen. /// © Jasmin Biber
Im Gespräch erzählt Felix Hoffmann, der künstlerische Leiter vom Foto Arsenal Wien und der Foto Wien, vom gebräuchlichen Ursprung des Passbildes beziehungsweise des Portraits. Der geht nämlich auf die Entwicklung von Identitätsdokumenten und fotografischer Technik im 19. Jahrhundert zurück. Zweck war es von Anfang an, Personen eindeutig zu identifizieren und Fälschungen oder Identitätsbetrug zu verhindern. Bereits in den 1850er Jahren wurden erste Identifikationsfotos für Polizeizwecke genutzt. Damit begann die Polizei systematisch, Mugshots (Verbrecher*innenfotos) von festgenommenen Personen anzufertigen. Mit der Weiterentwicklung der Fototechnik wurden diese Polizeifotos in Verbrecherkarten und Fahndungslisten integriert. In diesem Sinne ist die Fotografie nicht bloß Abbild, sondern Werkzeug - wie auch bei Höschl. Sein Fotobuch gleicht äußerlich einer Ermittlungsakte, nur hat sie keinen praktischen Nutzen, sondern bewegt sich im ästhetischen Spektrum.
Nun nimmt Höschl mit einem Blur diesen Fotos ihr Kernelement, das Gesicht. Die Absicht in der Entstehung war die Identifikation der Gefahr. Nimmt man ihnen jedoch die Identifikation, bleibt nur die Gefahr über, und die ist bei der Betrachtung spürbar, sie lässt einen nervös werden. Was bleibt also übrig, wenn die Person nicht zu identifizieren ist? Tattoos, Kleidungsstil, Kleidermarken wie Fred Perry etc.pp. Schließlich sind sie durch solche Codes und Symbole als Neonazis identifizierbar, durch die Fokusverschiebung fernab des Gesichts werden ihre Codes deutlicher sichtbar. Höschl selbst sieht sich nicht als Aktivist, er zeige nur auf neue strukturelle Zusammenhänge und stelle die Fragen anders.
Wie Alexander Winkler, Herausgeber des Buches Untergangster des Abendlandes. Ideologie und Rezeption der rechtsextremen Identitären, schon zu Beginn seines Impulsvortrags bei der Buchpräsentation betonte, ist eine Arbeit dieser Art gegenwärtig besonders wichtig. In einer Zeit, in der rechtsextreme Ideologien in Europa und weltweit wieder erstarken, erfüllt diese Arbeit eine dokumentarische und entlarvende Funktion. Höschl zeigt: Rechtsextreme blicken zurück, mit Kameras, mit Blicken und ihrer Körperhaltung – es ist eine visuelle Machtkonfrontation. Er verwandelt ein scheinbar harmloses Medium in einen Ort der Auseinandersetzung. Die gewaltsame Geschichte der Identifikation, von Kontrolle bis hin zu Repression, wird nicht nur erzählt, sondern verkörpert – im Material selbst. Diese sinnliche Qualität macht Gewalt nicht nur sichtbar, sondern fühlbar, ohne dabei voyeuristisch zu werden. Der künstlerische Umgang erlaubt es, Fragen zu stellen, die nicht rein argumentativ, sondern auf der Ebene von Form, Körper und Gefühl wirken. Kunst wie diese erweitert den Diskurs, sie schiebt sich zwischen Archiv, Buch, Raum und Installation. Höschls Buch ist relevant, weil es keine schnelle Antwort bietet, sondern ein Durchdringen verlangt, mit dem Blick, mit der Geschichte, mit der Gegenwart - und mit sich selbst.