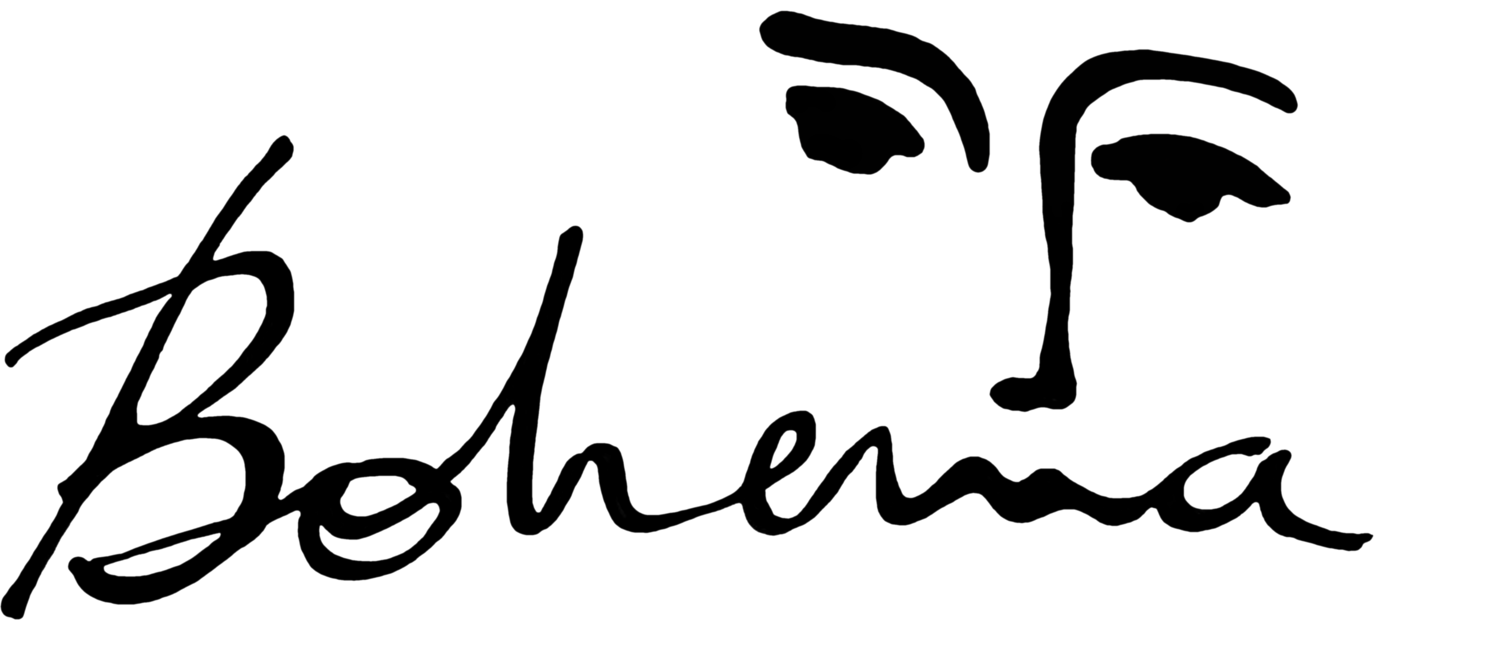„Die Aussage ist: das System ist hart“
Souleymanes Geschichte erzählt von einem Asylbewerber aus Guinea, der ohne Papiere als Essenslieferant in Paris arbeitet. Ein Gespräch mit Boris Lojkine, Regisseur des Films.
Boris Lojkine vor dem Stadtkino /// © Luca Wellenzohn
Boris Lojkine trifft uns im Stadtkino um über seinen neuen, preisgekrönten Film L’Histoire de Souleymane zu sprechen. Der Film zeigt die 48 Stunden vor Souleymanes Einvernahme bei der französischen Asylbehörde. Ohne Papiere radelt der Guineer als Fahrradkurier durch Paris und bereitet sich währenddessen auf die ausgedachte Geschichte vor, die er beim bevorstehenden Interview erzählen soll. Lojkine selbst ist gebürtiger Franzose und unterrichtete Philosophie an der Universität Aix-Marseille bevor er, zuerst mit Dokumentarfilmen, in die Filmbranche einstieg.
Bohema: Zunächst einmal: Willkommen im Stadtkino in Wien.
Boris Lojkine: Danke.
Bohema: Heute Abend werden Sie Ihrem Film L’Histoire de Souleymane (dt. Souleymanes Geschichte) dem österreichischen Publikum vorstellen. Was wünschen Sie sich für das Publikum heute Abend? Welche Emotionen oder neue Perspektiven möchten Sie mit Ihrem Film auslösen?
BL: Nun, ich kenne Österreich nicht gut genug, um zu wissen, wie der Film hier anders wahrgenommen werden könnte als an anderen Orten. Der Film bietet den Zuschauern eine sehr einfache Erfahrung. Er lädt die Zuschauer ein, zwei Tage mit Souleymane zu verbringen. Die ganz einfache Grundidee ist, dass wir solche Lieferanten kennen. Wir sehen sie vorbeifahren, wir sehen sie das Essen liefern, wir sehen sie auf ihren Fahrrädern warten – ich weiß nicht, ob es hier viele gibt, ich habe heute in Wien keine gesehen. Gibt es viele?
Bohema: Ja, es gibt schon viele.
BL: Ich habe nicht viele gesehen. In Paris gibt es, glaube ich, mehr.
Bohema: Hier fahren sie aber mittlerweile eher mit E-Rollern.
BL: In Paris gibt es beides, aber die, die einen E-Roller haben, werden eher von der Polizei angehalten, um kontrolliert zu werden. Deshalb sind die, die keine Papiere haben, normalerweise mit dem Fahrrad unterwegs. Jedenfalls gibt es viele Leute, die das in Paris mit dem Fahrrad machen, und diese Menschen gehören zu unserer Stadtlandschaft. Und viele Leute bestellen auch Essen, aber im Grunde wissen sie nichts über die Lieferanten. Es ist, als verliefen unsere Leben parallel. Selbst wenn ich Essen bestelle, bringen sie es mir und ich sage ihnen ‚Hallo‘ und ‚Danke‘ - fertig. Selbst wenn ich ihnen Trinkgeld gebe, werde ich es nicht einfach so in ihre Hand legen. Ich gebe es über die App. Alles passiert über das Telefon. Es gibt keinen Kontakt. Also, die Idee ist: ‚Okay, diese Menschen, die ihr kennt, aber nicht wirklich kennt, die ihr trefft, ihnen aber nie wirklich begegnet – ihr werdet zwei Tage mit ihnen verbringen und sehen, wie sich das auf eure Art, sie zu betrachten, auswirkt.‘ Und was ich mir natürlich erhoffe – und was mir viele Leute nach dem Film gesagt haben – ist: ‚Okay, jetzt schaue ich diese Lieferanten nicht mehr auf die gleiche Weise an. Wenn ich jetzt einen Lieferanten auf seinem Fahrrad vorbeifahren sehe, denke ich: ‚Ah, dieser Lieferant hat eine Geschichte.‘‘ Allein das ist schon riesig.
Darüber hinaus denke ich, dass der Film den Zuschauer mit einer ganz besonderen Emotion zurücklässt. Die letzte Szene ist sehr emotional – aber es ist eine ziemlich besondere Emotion. Es gibt viele Filme, die die Leute zum Weinen bringen. Das allein ist nicht originell. Was hier besonders ist, denke ich, ist eine Emotion, die den Zuschauer sehr auf sich selbst zurückwirft. Als ob der Lieferant dem Publikum einen Spiegel vorhält, mit dem man die eigene soziale Position reflektieren kann. Über die Tatsache, hier zu leben und dass es draußen auf der Straße diese Lieferanten, diese Sans-Papiers gibt, die in derselben Stadt wie wir, in derselben Welt leben, aber mit denen wir keinen Kontakt haben. Ich mag es, dass der Film die Zuschauer mit vielen Fragen zurücklässt.
Bohema: Wenn Souleymanes Geschichte als Fahrradkurier sich hier in Wien abspielen würde, wäre er wahrscheinlich ein Syrer oder ein Afghane. Ich glaube es gibt in Wien auch nicht viele Menschen aus Guinea. War es für Sie klar, dass sie in Paris die Geschichte eines Guineers erzählen wollen?
BL: Es ist so, dass ich in Paris Recherchen über die Lieferanten durchgeführt habe und gesehen habe, dass die Mehrheit der Lieferanten aus Westafrika kam und dass sie nicht zu den am häufigsten vertretenen westafrikanischen Gemeinschaften in Frankreich gehörten. In Frankreich sind das nämlich Menschen aus Mali und Senegal. Aber die Lieferanten gehören nicht zu diesen Gruppen. Die Lieferanten kommen aus Guinea oder von der Elfenbeinküste. Warum? Weil die Lieferanten zu den neuesten Gemeinschaften gehören, die also auch am meisten benachteiligt und am verletzlichsten sind. Es sind diese Menschen, die die Lieferungen machen. Ein Mann aus Mali, der ankommt – es kann schwierig für ihn sein aber er wird Menschen kennen. Er wird Familie haben, Verwandte, Leute aus dem gleichen Dorf und er wird Arbeit im Bauwesen finden. Er wird etwas Anderes finden. Deshalb gibt es unter den Lieferanten wenige aus Mali. Die Lieferanten sind Ivorer und Guineer, weil das sehr neue Gemeinschaften sind. Und warum wollte ich einen Guineer? Weil Guineer häufig Asyl beantragen. Also, wenn ich mich für einen Guineer entscheide, dann, weil – nachdem ich viele Lieferanten getroffen habe – es die Guineer sind, die die beiden Themen des Films vereinen: das Essen-Liefern und das Beantragen des Asyls.
Souleymane (Abou Sangaré) bei der Arbeit /// © Filmgarten
Doku oder Fiktion?
Bohema: Ich finde, dass der Film ziemlich realistisch ist, er erzählt eine Geschichte, die genau so hätte passiert sein können. Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Regiekarriere mit Dokumentarfilmen begonnen haben. Wie viel von dieser dokumentarischen Herangehensweise haben Sie sich für dieses Projekt beibehalten?
BL: Also im Herstellungsprozess ist es überhaupt kein Dokumentarfilm. Das heißt: nichts wird so gemacht wie bei einem Dokumentarfilm. Warum? Ich habe zuerst ein Drehbuch geschrieben. Erst nachdem ich das Drehbuch geschrieben hatte, habe ich nach den Leuten gesucht, die das Drehbuch spielen würden. Wir haben alle Szenen geprobt und dann haben wir mit einem Drehplan gedreht, bei dem wir jeden Tag wissen, welche Szene wir drehen müssen usw. Niemand wurde dabei in seinem eigenen Leben gefilmt. Aber die Inspiration war sehr dokumentarisch. Ich versuchte, etwas Dokumentarisches zu finden, aber mit den Mitteln des Spielfilms. Eine Geschichte zu erzählen, die sehr real ist. Um das zu tun, habe ich sehr viel dokumentiert. Ich habe meinen Schreibprozess mit der Dokumentation begonnen, indem ich auf die Straße gegangen bin, die Lieferanten getroffen habe und mit denen, die bereit waren, mit mir zu sprechen, einen Kaffee getrunken habe. Wir haben Zeit verbracht und ich habe sie sehr ausführlich interviewt. Ich habe das mit etwa fünfzehn Leuten gemacht. Das hat mir erlaubt, dokumentarisches Material zu sammeln. Auf dieser Grundlage habe ich dann geschrieben. Das ist sehr wichtig für mich, denn ich bin ein Weißer, der die Geschichte dieser Afrikaner erzählt. Ich kann nicht mit meinen eigenen Ideen kommen und meine Vorurteile auf ihr Leben übertragen. Es muss von ihnen kommen, von den Geschichten, die sie mir erzählen, von ihrer Art, Geschichten zu erzählen und von ihren eigenen Empfindungen. Andernfalls wird alles falsch sein. Also, das ist der erste Schritt: eine gründliche Dokumentation.
Die zweite Sache, die dem Dokumentarfilm nahekommt, ist das Casting mit Laien. Es gibt fast keine professionellen Schauspieler im Film. Die einzige professionelle Schauspielerin ist Nina Meurisse, die die letzte Szene spielt, die Beamtin der OFPRA, die das Interview führt. Abgesehen von ihr sind es nur Laien, also nur Menschen, für die wir ein Casting mit Laien durchgeführt haben und die alle im echten Leben dem Charakter, den sie spielen, sehr ähnlich sind. Also, die Lieferanten – abgesehen von Souleymane – sind echte Lieferanten. Der Kontoinhaber, ist auch jemand, der so ein Konto führt. Derjenige, der bei der Vorbereitung auf das Interview des Asylverfahrens hilft, hat das auch in der Realität gemacht. Die Polizisten sind Polizisten -
Bohema: Tatsächlich?
BL: Naja eigentlich sind sie Sicherheitskräfte im öffentlichen Verkehr, aber sie machen einen Polizistenjob und haben eine sehr spezifische Art zu sprechen, die wie die eines Polizisten ist. Ich kann das nicht erfinden. Wenn ich erfinde, wie ein Polizist spricht, wird es wie jedes beliebige Zeug aus dem Fernsehen klingen. Es wäre total doof. Aber sie haben eine sehr erstaunliche Art zu sprechen (lacht) und das ist die zweite Sache: ein Casting mit Laien, bei dem es nur Menschen gibt, die im echten Leben ihren Rollen sehr nahe sind.
Die dritte Sache ist, den Film so weit wie möglich in das echte Leben der Stadt einzubinden. Also, wir blockierten keine Straßen. Wir blockierten weder den Verkehr, noch die Passanten. Wenn wir in der U-Bahn drehen, gibt es Leute, die rauskommen und die keine Mitglieder des Teams sind. Es ist chaotisch, geht in alle Richtungen. Und so hat man das Gefühl, dass es die echte Stadt ist, die wir filmen. Es fühlt sich manchmal an, als ob wir einen Dokumentarfilm drehen, auch wenn wir überhaupt keinen Dokumentarfilm drehen.
Bohema: Also hatten Sie gar keine Statist*innen?
BL: Doch, wir hatten viele. Aber es gab auch viele, die keine Statist*innen waren. Zum Beispiel die Szene, in der er rennt und im letzten Moment in die U-Bahn springt und paff, die Türen der U-Bahn sich schließen. Das ist eine echte U-Bahn die ankommt, als wir diese Szene drehten, und die Leute, die aus der U-Bahn aussteigen, wussten nicht, dass es einen Dreh gibt.
Bohema: Muss man denn dann deren Erlaubnis einholen?
Boris Lojkine demonstriert den sogenannten "regard caméra" /// © Luca Wellenzohn
BL: Fuck them … (lacht) Nein, ich denke… normalerweise müsste man um Erlaubnis fragen. Aber ich glaube, man sollte es andersherum machen. Sonst ist es nicht möglich. Die Leute sind in der U-Bahn und sie steigen aus. Also ich denke, wir filmen einfach. Man sieht sie kaum, man erkennt sie nicht. Kurz gesagt: Wenn jemand ein Problem hat und sagt: ‚Was habt ihr da gefilmt?‘, erklären wir es ihm. Wenn er noch ein Problem hat, bezahlen wir ihn, und wenn er noch ein Problem hat, sagen wir: ‚Okay, der Shot kommt in den Mülleimer.‘ So einfach ist das. Wir drehen es einfach noch einmal. Aber so haben wir die Energie der echten Stadt. Wenn man im Voraus die Passanten einweiht ist es unmöglich. Oder wenn man fürchtet, die Passanten werden in die Kamera schauen. Das haben mir viele zu Beginn gesagt: ‚Aber da werden dir die Passanten in die Kamera schauen.‘ Also wenn du so frontal in die Kamera schaust - (Er demonstriert es mit unserem Fotografen, der genau in diesem Moment abdrückt) - so, ich habe gerade das gemacht, was verboten ist. Wenn du so in die Kamera schaust, verdirbt das das Bild. (lacht) Das verdirbt auch den Shot. Aber in Wirklichkeit passiert das nicht so oft. In Paris,kümmern sich die Leute nicht darum. Jeder geht seinen Weg, sie wollen einfach keine Zeit verschwenden. Sobald sie merken, dass da nicht Tom Cruise steht, juckt es sie nicht.
Bohema: Verstehe. (lacht)
Bohema: Das Drehbuch hat also bereits vor dem Casting existiert. Hat es sich nach dem Casting, als die Schauspieler*innen feststanden, verändert?
BL: Ich würde sagen, auf zwei Weisen… einmal für das gesamte Casting und für Abou Sangaré ist es noch einmal besonders. Für das gesamte Casting war es so, dass ich sie die Szenen zusammen proben lasse, aber ihnen keinen Text zum Auswendiglernen gebe. Ich erkläre ihnen die Szene, was passiert, wie es passiert, was die Situation ist, und wir versuchen es gemeinsam zu spielen. Wir machen Improvisationen und dann sehen wir, wie es funktioniert, und oft läuft es dann ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist normal.
Manche Dinge kann ich mir nicht ausdenken. Es gibt eine Szene im Film, in der die Lieferanten in der Straße essen und die Guineer und die Ivorer Witze untereinander machen. Ich kann diese Witze nicht erfinden. Das würde keinen Sinn ergeben. Noch einmal: Ich bin nur ein kleiner weißer Kerl. Wenn ich Witze über Guineer und Ivorer erfinde, ist das total doof. Solche Szenen entstehen typischerweise aus der Improvisation, die wir machen. Wir machen viele Improvisationen, ich sehe, was am besten funktioniert, und das halten wir fest. Das kommt dann ins Drehbuch. Oder auch die Szene mit den Polizisten… Ich weiß, was in der Szene passieren soll… aber wie genau es ablaufen soll, weiß ich nicht. Nun, die Polizisten bringen ihre eigene Art zu sprechen mit und ihre eigene Art, Dinge zu tun. Nach all diesen Proben schreibe ich das Drehbuch neu, ich nehme alles, was wir gefunden haben, und packe es ins Drehbuch. Am Ende haben wir ein Drehbuch, das realistischer und gerechter ist und besser auf die Schauspieler abgestimmt ist. Das ist jedenfalls meine Methode, wenn ich mit nicht-professionellen Schauspielern arbeite. Es ist sehr wichtig, es so zu machen. So werden sie gut spielen. Wenn man ihnen etwas gibt, das ihnen vertraut ist.
Bei Sangaré - also Souleymane - war es noch etwas anders. Bei ihm habe ich Elemente seiner persönlichen Geschichte genommen um sie in den Film einzubringen. Das ist etwas Anderes. Ich habe vor allem das genommen, was er am Ende erzählt, wenn er seine wahre Geschichte erzählt, seine Reise, seine Mutter, seine Familiensituation in diesem Moment. Hier spricht Sangaré als Souleymane eigentlich über sich selbst. Als Sangaré in den Film kam, bekam die Gestaltung der Rolle Souleymane eine zusätzliche Schicht. Das heißt, etwas, das ich nicht wirklich durch das Schreiben hätte finden können, wurde durch den Schauspieler gefunden. Die ganze ‚Backstory‘ kam eigentlich erst mit dem Schauspieler.
© Filmgarten
Bohema: Eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist der Titel des Films - Souleymanes Geschichte bzw. L’Histoire de Souleymane. In Wirklichkeit gibt es aber mehrere Geschichten. Es gibt die erfundene Geschichte, die er für das Interview versucht einzustudieren, dann die Geschichte dieser zwei Tage, die nicht die ganze Lebensgeschichte von Souleymane ist, und auch die Geschichte von Abou Sangaré, dem Schauspieler selbst. Und ich habe mich gefragt, was Ihre Idee hinter diesem Titel war?
BL: Genau das.
Bohema: Genau das? (lacht)
BL: Ja (lacht) ‚Souleymanes Geschichte‘ bedeutet, dass wir euch Souleymanes Geschichte erzählen werden. Aber gleichzeitig ist es die Geschichte von jemandem, der sich darauf vorbereitet, eine „Geschichte“ zu erzählen. Und im Grunde genommen ist die große dramatische Spannung des Films - wenn es überhaupt ein gibt - herauszufinden: Was ist die wahre Geschichte von Souleymane? Du hast recht, es gibt drei Ebenen. es gibt das alltägliche Leben von Souleymane, es gibt die falsche Geschichte, die er wiederholt und die er erzählen muss, um Asyl zu bekommen, und dann gibt es die wahre Geschichte von Souleymane, die sein Geheimnis ist und die er uns am Ende enthüllen wird.
Migrationsgeschichten erzählen als episches Kino der Realität
Bohema: Es ist nicht Ihr erster Film zum Thema Migration, aber hier ist es ein anderer Aspekt des Themas, den Sie erforschen -
BL: Es ist ein bisschen die Fortsetzung…
Bohema: Ja. Was war Ihr ursprüngliches Interesse an diesem Thema? Wie kamen Sie dazu an diesem Migrationsthema zu arbeiten?
BL: Was mich anfangs angezogen hat, war der epische Charakter. Die Reise der Migranten ist eine Odyssee. Diese Reisen durch ganz Afrika, einen ganzen Kontinent, ohne Papiere, in denen sie heimlich die Grenzen überqueren, vielen Gefahren gegenüberstehen - mit der Polizei, dem Militär, Banditen, der Wüste, dem Meer, den Stürmen… für mich ist das eine sehr außergewöhnliche Reise. Und ich denke, was mich als Filmemacher daran angezogen hat, war der Eindruck, dass ich mit diesem Thema zwei Dinge verbinden kann, die manchmal getrennt sind: Einerseits das Kino der Realität, das ein Kino ist, das sehr nahe am Dokumentarfilm ist und sehr darauf bedacht ist, die Realität zu beschreiben, und gleichzeitig ein episches Kino, das ein großes Abenteuer erzählt. Aber was ist episches Kino? Nun, episches Kino erzählt von großen Schlachten, dem Ersten Weltkrieg, den Kreuzzügen und so weiter… Aber in Wirklichkeit, wenn man die Reise von Migranten erzählt, kann es episches Kino sein, das gleichzeitig ein Kino der Realität ist, sehr nahe am Dokumentarischen. Man kann beides verbinden. Und der Wunsch, beides zu verbinden, hat mich zu diesem Thema geführt. Und wahrscheinlich, auf eine weniger intellektuelle Weise, gibt es etwas, das mich an den Reisen der Migranten sehr berührt. In meinem eigenen Leben war das Reisen prägend. Ich würde heute keine Filme machen, wenn ich nicht angefangen hätte zu reisen. Ich würde sagen, dass ich mich im Reisen selbst gefunden habe. Ich finde Figuren, die reisen, immer interessant.
Cowboys auf Fahrrädern
Bohema: Also im Fall von L’Histoire de Souleymane ist das Epische dann das Fahrradfahren durch Paris?
BL: Nein, das ist der Western. Im Western sitzt ein Cowboy auf seinem Pferd mit seiner Pistole. Hier ist es der Lieferant auf seinem Fahrrad mit seinem Telefon. Es ist ein urbaner Western.
Bohema: Wie haben Sie eigentlich die Dynamik des Fahrrads eingefangen?
© Luca Wellenzohn
BL: Mit anderen Fahrrädern.
Bohema: Also war die Kamera auch auf einem Fahrrad?
BL: Ja, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Wenn ich zu Fuß bin und das Fahrrad im Panorama filme, ist das ein sehr langweiliger Shot. Wenn ich im Auto bin, wird das Auto durch den Stau gestoppt. Wenn ich auf einem Motorrad bin, muss das Motorrad trotzdem ein bisschen die roten Ampeln respektieren, aber, wenn ich auf einem Fahrrad bin, kann ich alles machen. Man muss also auf einem Fahrrad sein. Was haben wir also gemacht? Wir haben ein Lastenfahrrad genommen, ein Fahrrad mit einem großen Korb vorne, und den Kameramann in den Korb gesetzt, mit einem Arm, der ‚Easyrig‘ heißt, der die Kamera aufhängt, die Kamera so hält (er zeigt es mir) um die Kamera ein bisschen zu stabilisieren. Also der Kameramann sitzt vorne auf dem Fahrrad, und jemand anderes fährt.
Bohema: Und für den Ton?
BL: Der Ton wird von einem anderen Fahrrad aus gemacht. Normalerweise fahre ich das Tonfahrrad, und der Toningenieur sitzt hinter mir. Es ist ein großes Fahrrad, das nennt sich ‚Longtail‘, wir sitzen wie die Leute, die ihre Kinder transportieren, wenn sie Zwillinge haben. Also haben wir den Toningenieur hinten, der gerade mixt, eine große Antenne und Mikros überall auf dem Fahrrad, sogar innen. Mikros auf dem Kopf von Sangaré, einen Recorder in der Liefertasche, Mikros auf dem Kopf des Kameramanns… sehr viele Mikros.
Bohema: Das hätte ich gerne gesehen...
BL: Also, es gab tatsächlich etwa drei Fahrräder rund um Sangaré. Ein Fahrrad für die Kamera, ein Fahrrad für den Ton und oft noch ein Fahrrad für einen Assistenten, der versucht sicherzustellen, dass alles gut läuft.
Blau
Bohema: Ich habe auch bemerkt, dass die Farbe „Blau“ im Film sehr dominant ist. Schon alleine im Trailer ist mir das aufgefallen. War das Ihre Entscheidung oder die der Kostümbildnerin?
BL: Nein, das war nicht die Kostümbildnerin, sondern eher der Kameramann. Aber mit mir zusammen. Was wir vor allem entfernt haben, ist das Grün, also alles, was pflanzlich ist. (Er zeigt dabei auf die Tulpe auf dem Tisch) Ich wollte nicht, dass es Pflanzen im Film gibt. Wir wollten ein urbanes Universum schaffen und eine gewisse Härte der Stadt zeigen. Daher wollten wir keine kleinen hübschen Blumen oder warme Farbtöne zeigen. Es stimmt also, dass wir eher kalte Töne wie Blau und Grau im Film haben. Der Himmel ist grau, es ist November. Es regnet viel in Paris. Das ist die Stadt, die ich darstellen wollte. Ich habe mir gedacht, für einen Afrikaner in Paris... es muss so kalt und nass sein. Diese ganze kalte Welt in Blau und Grau… In Afrika ist der Boden rot, die Sonne ist sehr heiß und es gibt viele Farben. Daher haben wir dieses visuelle Spiel mit den Farben, um dem Zuschauer eben dieses Gefühl einer harten Stadt zu vermitteln. Wir haben die warmen Farben entfernt und für die Beleuchtung haben wir Neonlichter bevorzugt. Weißes statt gelbes Licht.
© Filmgarten
Abou Sangaré als Souleymane
Bohema: Erst gestern hat Ihr Hauptdarsteller, Abou Sangaré, erneut einen Preis gewonnen für seine Rolle als Souleymane.
BL: Ja... wir haben gestern vier Preise gewonnen!
Bohema: Voll. Und er hat den César für den besten männlichen Nachwuchsdarsteller gewonnen. Dabei ist er gar kein professioneller Schauspieler. Wie haben Sie ihn eigentlich gefunden?
BL: Wir haben ein großes Casting mit Laien gemacht. Um einen guineischen Lieferanten zu finden, sind wir zu Beginn auf die Straße gegangen und haben nach guineischen Lieferanten gesucht. Wir haben Dutzende getroffen, und schließlich Hunderte… aber keinen passenden gefunden. Irgendwann haben wir beschlossen, außerhalb von Paris suchen. In anderen Städten, in denen es viele Guineer gibt. So kamen wir nach Amiens, eine kleine Stadt im Norden von Frankreich. Dort gab es einen Verein, der für uns 25 junge Guineer zusammengebracht hat. An diesem Tag haben wir alle 25, einen nach dem anderen, getroffen, und am Abend haben wir vier von ihnen noch einmal gesehen. Unter diesen vier war dann schließlich auch Sangaré. Er hat uns sehr gefallen, und wir haben ihn dann in der folgenden Woche nach Paris eingeladen um den ganzen Tag lang Tests zu machen. Der Zeitrahmen war bereits sehr eng. Nach diesen Tests in Paris hatte ich wirklich das Gefühl, ihn kennengelernt zu haben. Wir haben viel miteinander gesprochen - den ganzen Tag eigentlich - und danach haben wir sehr schnell entschieden, dass er es ist.
Bohema: Und mit welchen Qualitäten oder Merkmalen hatte er Sie überzeugt?
BL: Es ist immer schwierig, dafür Worte zu finden. Deshalb filmen wir beim Casting immer die Kandidat*innen, weil es in der Bildsprache eine Art Selbstverständlichkeit gibt. Ich denke, Sangaré hat eine große Spannung in sich, er ist sehr angespannt im Inneren. Wenn man ihn genau ansieht, passiert viel auf seinem Gesicht, man hat das Gefühl, dass er jederzeit explodieren könnte. Gleichzeitig ist er sehr sanft.
Bohema: Ja, sehr sanft!
BL: … und ich denke, es ist genau der Kontrast zwischen dieser großen Sanftheit und dieser inneren Wut, der ihn sehr interessant macht.
Bohema: War denn die Person, die Sie sich für Souleymane vorgestellt haben, bevor Sie Sangaré getroffen haben, bereits so eine Person?
© Filmgarten
BL: Ehrlich gesagt, hatte ich große Schwierigkeiten, mir Souleymane vorzustellen. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man Drehbücher über Charaktere schreibt, die sehr weit von der eigenen Realität entfernt sind. Aber ich wusste, dass ich für die Geschichte des Films jemanden brauchte, der ziemlich angespannt ist. Ich brauchte jemanden, der – das ist das Erste, worauf man beim Casting achtet – jemand, den man anschaut und bei dem man sich keine schlechten Fragen stellt. Man denkt nicht: „Ah, aber er sieht unehrlich aus, oder unangenehm…“. Und dann wollte ich auch niemanden, der zu weich ist. Mit jemandem, der zu weich ist, würde es beim Filmen sofort langweilig werden. Aber jemand, der eine Art innere Spannung hat, der macht das Bild intensiver.
Bohema: Sie als Regisseur haben sich auch entschieden, eine Rolle im Film zu übernehmen.
BL: Ja, eine sehr gute Rolle (lacht).
Bohema: War es die Idee eines Cameo-Auftritts?
BL: Nein. Meine Idee ist es, Rollen zu besetzen mit Leuten die keine Profis sind, und es ist wirklich schwer zu schauspielern. Wenn man spielt, wird man albern. Wenn man eine Kamera vor sich hat weiß man nicht mehr wie man heißt, man vergisst alles. Wenn ich in meiner Position als Regisseur die Leute in solch eine Situation bringe, finde ich es wichtig, dass ich mich daran erinnere, dass es schwer ist. Also mache ich es auch. An dem Morgen, an dem wir das gefilmt haben, habe ich mir gesagt: „Boris, warum hast du das gemacht? Was für eine schlechte Idee!“ Ich war sehr gestresst. Ich hatte richtig Lampenfieber. Dabei habe ich das schon in anderen Filmen gemacht. Aber ich hatte viel Lampenfieber, ich dachte nicht, dass ich ein guter Schauspieler sei. Das ist aber auch nicht der Punkt, und das ist nicht mein Ziel. Ich finde es einfach wichtig, mich daran zu erinnern, dass Schauspiel schwierig ist. Die anderen am Set lachten, sie machten sich auch über mich lustig (lacht), und das stellte wieder eine Art von Gleichstellung zwischen uns her. Das war mir wichtig.
Bohema: Wenn ich mich richtig erinnere, war Ihre Rolle fast die unangenehmste Person des Films… (lacht) Warum haben Sie gerade diese Rolle für sich ausgewählt?
BL: Naja, wenn ich schon eine Rolle im Film spiele, dann werde ich mir keine schöne Rolle aussuchen. Moralisch gesehen ist das für mich unmöglich.
Kleine Momente der Menschlichkeit
Bohema: Ich erinnere mich auch an eine andere Szene, in der Souleymane eine Bestellung in einem Restaurant abholt und die Person, die dort arbeitet, bietet ihm ein Bonbon (Zuckerl) an. Das ist ein sehr großer Kontrast, finde ich. Was war die Idee hinter diesem Charakter?
BL: Insgesamt ist der Film hart. Er zeigt das Gefühl, das man von der Stadt Paris hat als einer Welt, die um Souleymane herum existiert, die sehr feindlich und kalt ist. Es ist sehr wichtig, dass es in dieser feindlichen Welt kleine Momente der Menschlichkeit gibt. Es gibt nicht viele im Film: die chinesische Frau, die ihm ein Bonbon gibt, der Kebab-Mann, der ihm einen kostenlosen Kaffee ausgibt, sein Bett-Nachbar, der nett ist und mit ihm spricht, der alte Mann, der ihn fragt, wie er heißt, als er die Pizza liefert. Das sind die kleinen Momente, und das ist wirklich wichtig. Wenn man einen Film in einer einzigen Farbe macht – alles ist schwarz, alles ist schrecklich – dann wird der Zuschauer ziemlich schnell eine Distanz dazu aufbauen. Es ist wie beim Sehen von Farben… man braucht Kontraste. Wir werden die Härte dieser Welt umso mehr spüren, wenn es darin auch nette Leute gibt. Die netten Leute sind wie ein Relief, der uns hilft, auch die Schwierigkeiten zu fühlen. Der Sinn des Films ist nicht zu sagen: „Alle Franzosen sind schrecklich“ oder „alle Pariser sind Arschlöcher“. Die Aussage ist: „Das System ist hart“. Aber im System gibt es ein paar nette und ein paar böse Menschen, es gibt Idioten wie mich, es gibt Menschen, die einfach nett sind und Zuckerl verteilen... so ist es. Aber die wichtige Idee ist, dass man nicht sagen soll, dass alle Franzosen böse sind. Wenn man in die Karikatur geht, wird der Zuschauer eigentlich nichts mehr fühlen.
Bohema: Ich finde, dass man nicht den Eindruck hat, dass irgendwer im Film böse ist. Sogar die Polizisten und –
BL: Es gibt keine bösen Menschen im Film. Die Polizisten sind ein bisschen blöd… aber in Frankreich gibt es viel schlimmere Polizisten.
Bohema: – und auch, nehme ich an, noch schlimmere Personen, die im OFPRA die Interviews durchführen.
BL: Das Interview, natürlich. Es ist sehr wichtig, dass die Frau, die das Interview führt, nicht böse ist. Sie könnte eine Böse sein, ich könnte eine verbitterte, böse, unangenehme Frau zeigen… ich habe solche Frauen gesehen, die gibt es auch. Aber es gibt auch nette. Es gibt alles. Mir ist sehr wichtig, dass sie keine Böse ist, sonst wäre es so, als würden wir „unser Asylsystem“ zum Thema des Films machen und die Institution, die Asyl gewährt, verurteilen. Aber ich denke nicht schlecht über das Asyl. Es ist großartig, dass es eine Institution gibt, die Menschen Asyl gewährt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist: Was machen wir mit denen, die nicht in die Raster passen, die die Verwaltung und die Behörden vorgeben?
…was nun?
Bohema: Abschließend möchte ich sie fragen: Haben Sie darüber nachgedacht, was der Film beim Publikum verändern könnte in Bezug auf die Nutzung von Liefer-Apps?
BL: Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, aber jetzt, nach dem vielen Kontakt mit dem Publikum, sprechen mich die Leute oft darauf an. Einige sagen mir: „Ach, ich werde aufhören mir Essen zu bestellen, das ist schlecht.“ Ich weiß nicht, ob ich das denke, weil… na ja, ich kenne jetzt viele Lieferfahrer und sie wollen nicht, dass wir die Bestellungen stoppen. (lacht) Sie sagen mir: „Nein, nein, stoppt die Bestellungen nicht… gebt Trinkgeld.“
(übersetzt aus dem Französischen)
© Luca Wellenzohn
Souleymanes Geschichte läuft im Moment im Kino - in Wien u.a. im Stadtkino, im Burg Kino und im Votiv Kino. Spieltermine und Filminformationen hier.