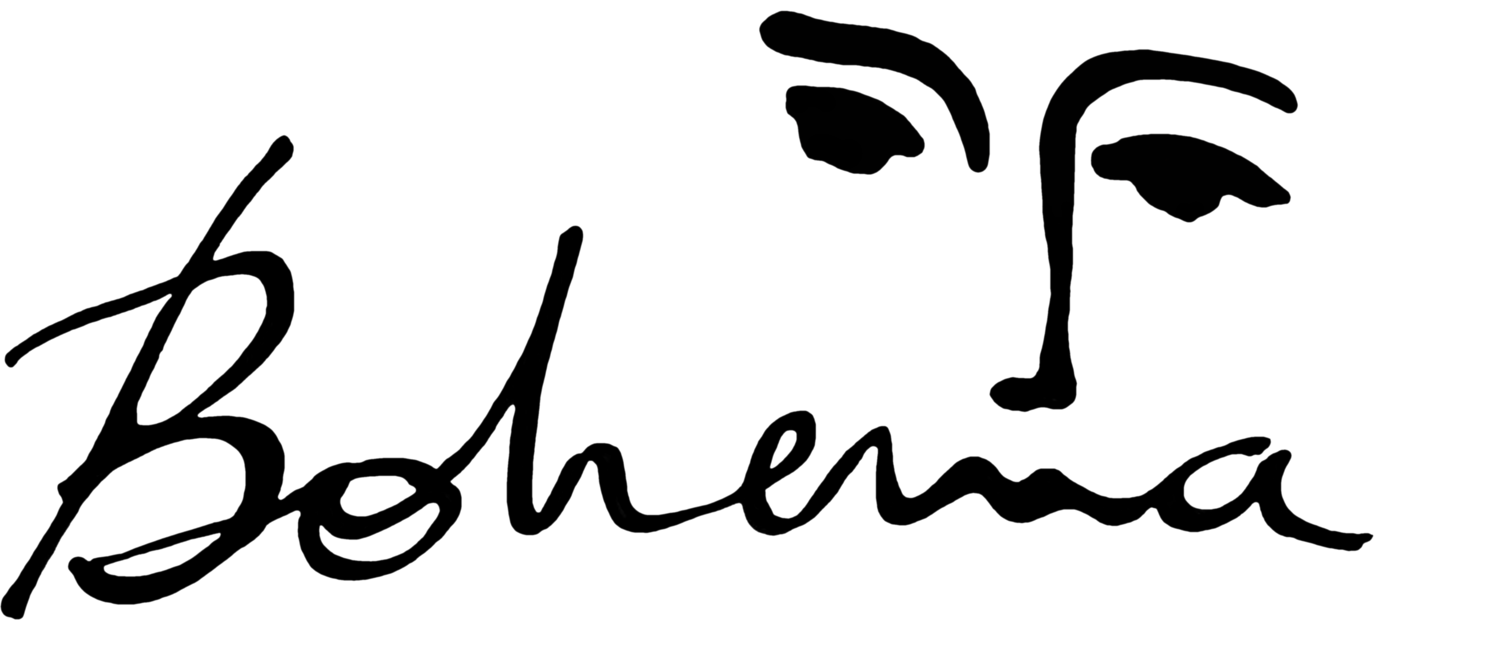Thomas Bernhard hätte uns alle gehasst
Das Burgtheater fasst Thomas Bernhards Ehrbeleidigung der Wiener Kulturszene Holzfällen. Eine Erregung auf. Kann das funktionieren?
Nicholas Ofczarek, Franui /// © Tommy Hetzel
Ofczarek sitzt vorne zentral auf der Bühne, um ihn herum ist das Ensemble der Musicbanda Franui als Halbkreis positioniert, bei dem jede Person Richtung Erzähler gewandt ist. Alle Personen sind vollkommen in schwarz gekleidet, das Bühnenbild ist ein schwarzer Vorhang, eine Black Box. Es wirkt, als wäre hinter den Spielenden ein großes, dunkles Nichts, wie der Abgrund der Wiener Kulturelitenhölle, der uns durch die folgenden Worte und die untermalende Trauermusik erzählt wird.
Wieso im Burgtheater?
Nicholas Ofczareks kräftige Stimme, die von der Musik stimmig begleitet und getragen wird, lässt uns auch die erzählerische Meinung über den heutigen Veranstaltungsort und die dort Spielenden wissen. Der verunglimpfte Burgschauspieler ist „einer jener geistlosen Brüller“, die aus dem Burgtheater „eine Dichtervernichtungs- und Schreianstalt der absoluten Gehirnlosigkeit gemacht haben“. Der Text Thomas Bernhards ist besonders mit dem Prototyp Burgschauspieler, der durch sein Auftreten auch die Inszenierung deutlich verändert, verknüpft. Vor seinem Erscheinen ist die Aufführung von sich wiederholenden Monologen gekennzeichnet. Nachdem der Schauspieler nun spätnachts zum Abendessen eintrifft (man hat naturgemäß mit dem Mahl auf ihn gewartet), ändert sich dies. Statt ständigen Rückblenden voller Wortwiederholungen, folgen wir der Handlung des gerade geschehenden Abendessens. Doch kommt der Burgschauspieler als Figur im Text Bernhards deutlich schlechter davon als in dieser Inszenierung. Sein faktisch falsches Selbstlob, ebenso wie der Versuch seine tatsächliche Rolle in Ibsens Die Wildente zu verschleiern, wird nicht aufgegriffen. Wieso dieser Text ausgerechnet im Burgtheater gespielt wird, kann nur gemutmaßt werden. Vielleicht wollte man besonders selbstironisch sein, oder man ist sich der Beliebtheit Bernhards beim Publikum bewusst, doch es könnte auch die leise Hoffnung auf eine anti-bernhardsche Redemption des eigenen Hauses sein. Doch eines scheint trotz aller Bedenken klar: ein Schlüsseltext von Österreichs Lieblingsgrantler kann nur von den Verunglimpften selbst aufgegriffen werden, alles andere würde sich wie ein Anbiedern an Kritik anfühlen, die man genauso auf die anderen Spielorte umdeuten könnte.
Versteht das hier irgendjemand?
© Tommy Hetzel
Zu Lebzeiten wurde versucht die Österreich-Kritik von Bernhard zu unterbinden. Die Mehrheitsgesellschaft fühlte sich angesprochen und war dementsprechend darum bemüht die Texte zu verbieten, was die Inhalte weiter unterstrich. Heutzutage wird Bernhards Wut oft in einer Zähmung des skandalösen Autors gelesen. Sein Schimpfen wird abgekultet, Bernhard ist seit 1989 tot. Das Publikum ist mittlerweile distanziert vom Inhalt, trotz des Wissens selbst mitgemeint zu sein. Dennoch oder genau deswegen gelingt es dieser Inszenierung den Stoff in die Gegenwart zu bringen. Vielleicht hat sich ja in den letzten vierzig Jahren gar nicht so viel verändert? So wie der Ich-Erzähler in Thomas Bernhards Textvorlage in einem Ohrensessel sitzt und die Gesellschaft eines „künstlerischen Abendessens“ beobachtet, sitzt Nicholas Ofczarek dem Publikum gegenüber. Durch die Position werden wir zur verhassten Gesellschaft. Das Lachen der zahlenden Burgtheaterkund*innen ist zwar an den richtigen Stellen zu hören, jedoch wirkt es immer wieder performativ. Es scheint, als ertöne die Erheiterung einiger bei jeder Erwähnung des Burgtheaters, um ja zu untermalen, wie absurd die Situation ist. Dass ein Großteil der Anwesenden, der gerade über die peinliche Kulturelite lacht, für eine einzige Theateraufführung zwischen fünfzig und siebzig Euro gezahlt hat, wird dabei nonchalant ignoriert. Auch bekommt dieses Burgtheaterlachen einen arroganten, beinahe verachtenden Beigeschmack, wenn sich über das ländliche Österreich oder das Volkstheater lustig gemacht wird. Hier wird gleich doppelt so laut geprustet. Es wirkt ausgelassener und ehrlicher, wenn über andere gelacht wird.
Unstimmig stimmig
Man hat das Gefühl die Groteske der Gesamtsituation gar nicht richtig einfangen zu können. Dies wird vor allem am Schluss der Produktion klar. Dem Ich-Erzähler wird schleichend bewusst, dass auch er Teil dieser verhassten Gesellschaft ist. Die Tragödie des Erzählers macht auch vor ihm selbst nicht halt, egal wie viele Schimpfworte er den anderen gedenkt. Das Publikum lacht, während die Stimme, die uns durch über 120 Minuten geführt hat, ein jämmerliches, auseinanderfallendes Schlussplädoyer hält. Es ist schließlich ein grundmenschlicher Abwehrmechanismus über eigene Ängste zu lachen.