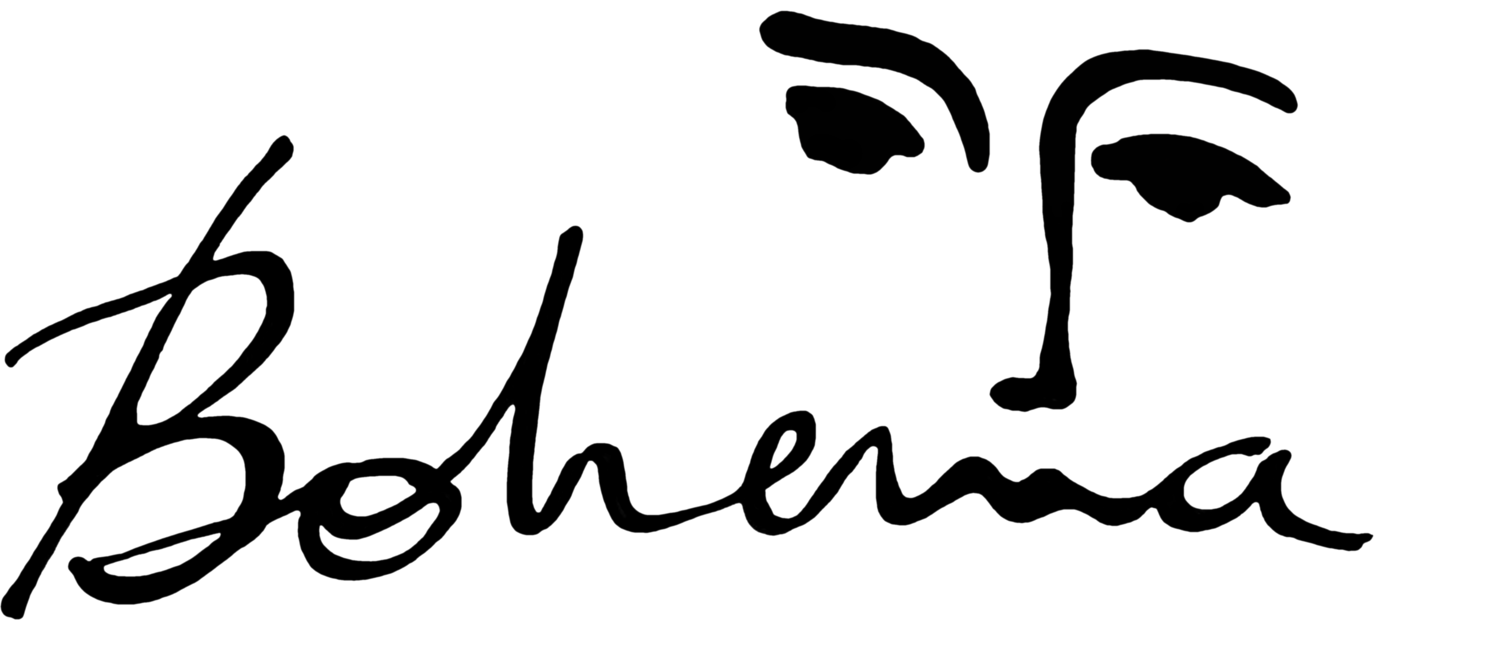Zerstörung der Nylonstrümpfe
Das Alter ist nur eine Zahl? Wenn es um Sexualität und Liebesleben einer Frau geht, sieht das gleich ganz anders aus. Was haben ein Tisch und Nylonstrümpfe damit zu tun? Das Kosmostheater zeigt mit Der junge Mann eine Inszenierung zwischen radikaler Selbstbestimmung und Ageism.
© Bettina Frenzel
Die Texte von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux sind messerscharf und gleichzeitig zerbrechlich ehrlich. Doch Der junge Mann im Kosmostheater bietet weit mehr als nur eine szenische Umsetzung von Ernaux‘ Erzählungen. Im Sog eines metapherntriefenden Bühnenbilds und den melancholisch-elektropoppigen Tönen von Teresa Rotschopf will einen diese Inszenierung von Elisabeth Gabriel nicht loslassen. Und der Diskurs ist simultan auch auf der Leinwand mit Halina Reijins Film Babygirl (2024) aktuell, der sich wie Ernaux Werk aus dem Jahr 2022 mit der Affäre einer älteren Frau zu einem jungen Mann beschäftigt.
Andersherum sind die Stigmata blass, ja fast normalisiert, das Bild eines älteren Mannes mit einer jungen Frau am Arm gilt als Normalität.
Die Protagonistin will einen Orgasmus erleben, um die Inspiration zum Schreiben zu finden. Doch die Beziehungen, auf die sie sich einlässt, bieten tiefgreifendere Schreibmaterie als sie dachte. Und so webt sie aus der Affäre mit einem jungen Mann, aus der das Publikum nur Ausschnitte gezeigt bekommt, eine Verbindung zu ihren jugendlichen Erfahrungen. Positiv waren diese nicht. Johanna Orsini und Lili Winderlich verkörpern repräsentativ die Binarität von jung und alt. Ihre Figuren wechseln sich in der Erzählstromtechnik, die immer wieder Einblicke in Gegenwart und Vergangenheit gewährt, dynamisch ab. Dabei entsteht ein intimer Einblick in die Gefühlswelt der Protagonistin und ihren inneren Kampf gegen die Traumata der Vergangenheit, aber auch das Stigma der sexuell aktiven, älteren Frau.
In kurzen rhythmischen Intermissionen oder untermalenden Sounds mit Loop-Station begleitet Rotschopf das Spiel und verleiht den Szenen einen melancholischen Unterton. Auch Orsini und Winderlich ergreifen gelegentlich das Mikrofon, um den Szenen mit Gesang Nachdruck zu verleihen. Dennoch bleibt die Inszenierung nicht auf einer Erzählebene hängen, sondern greift zurück in die Vergangenheit. Hier werden die Erinnerungen an die Abtreibung der Protagonistin aufgearbeitet und gleichzeitig mit der Beziehung zu dem jungen Mann verbunden. Kann sie ihre Erinnerungen neu und positiv umdeuten? Es liegt schwer im Raum: die ehemalige Affäre, die nie von der Abtreibung wusste und die damit erzeugte Doppeldeutigkeit in der Beziehung zu diesem jungen Mann. Repräsentiert er in gewissen Zügen dieses Trauma? Hätte er aus ihr herauskommen können, wie er es selbst in einem Wunsch beschreibt?
Bühnenbild eines „KILLJOYS“
Zentral ist das minimalistische Bühnenbild aus Tisch, Stühlen, vereinzelten Büchern und einer netzartigen Struktur, die die Bühne wie Nylonstrümpfe umhüllt (Bühne: Cristina Milea). Die Assoziation der Schriftstellerin am Tisch kann in Relation zu feministischer Theorie eine tiefgehendere Bedeutung entfalten: Nach Sara Ahmeds Feminist Killjoy-Argumentation sieht die Realität eines “Killjoys” am Diskurs-Tisch so aus: “If philosophers withdraw from something in order to inspect it, the killjoy as philosopher inspects something because we are withdrawn from it.”
“Killjoys” sind Personen, beispielsweise Philosophinnen, die Themen analysieren und diskutieren, gerade weil sie nicht Teil des weißen, heteronormativen Diskurses sind, der sie ausschließt. Diese Theorie fängt bei den Erfahrungen von Frauen an, hört aber nicht bei den Themen Blackness oder Queerness auf, ganz im Gegenteil:
„The table can be where we are asked questions, or where we become the question. To be killjoy philosopher is to turn the question out. We question who is made questionable and who is not.”
Gleichzeitig analysieren „Killjoys“, wieso das eine als „normal“ angesehen wird, aber in anderem Kontext von bspw. weiblicher Erfahrung stigmatisiert wird. So ist diese Theorie auch anwendbar auf Ernauxs Erzählung über eine Affäre mit einem jüngeren Mann, die bei Frauen gesellschaftlich stärker hinterfragt wird als in umgekehrter Form. In Kombination mit den Nylonstrümpfen auf der Bühne, die mit Weiblichkeit aber auch mit Schönheitszwängen verbunden werden können, entsteht ein symbolträchtiges Bild. Nicht zuletzt das Kostüm von Ingrid Leibezeder, die den Schauspielerinnen Teile eines männlich konnotierten grauen Anzugs verpasst und somit simultan mit der Symbolik von Männlichkeit und Macht in der Kleidung spielt, vervollständigt die metapherngeladene Inszenierung.
Radikale Selbstbefreiung
Die Beziehung, die die Protagonistin in ihren Fünfzigern mit dem jungen Mann um die fünfundzwanzig führt, ist vielschichtig. Da sind zudem die Blicke anderer Frauen ihrer Generation, die sie aufgrund ihres Alters und Attraktivität abwerten, sich gleichzeitig aber selbst die Möglichkeit ausrechnen mit einem „jungen schönen Mann“ auszugehen. Auch wenn die Selbstzweifel kurzweilig sind, kehren sich die Gefühle der Protagonistin schließlich in ein radikales Gegenteil: In ein Gefühl der Befreiung, der „ihr könnt mich alle mal“-Attitüde, dass diese Beziehung einfach so sein darf. Laut und wütend bricht es aus Orsini und Winderlich, die in ihrer Ekstase das Bühnenbild auseinandernehmen, den Tisch zur Seite werfen, hier die Wut auf die Tischmetapher entblößen.
Begonnen hatte die Geschichte auf der Suche nach einem Orgasmus. Enden tut dieses literarische Begehren mit einer Auseinandersetzung, die ein sexuelles Motiv umkreist und letztendlich die Bedeutung der Sexualität der Frau im Alter, aber auch in der Jugend ergründet. Der junge Mann ist ein siebzigminütiger intensiver Abend, der in seiner Art des wechselnden Erzählstroms, welcher oft ernüchternd wirken kann, keine Sekunde zu lang ist.
Quelle
Ahmed, Sara. The Feminist Killjoy Handbook. Penguin Books, 2024, (S. 135 & S. 146)