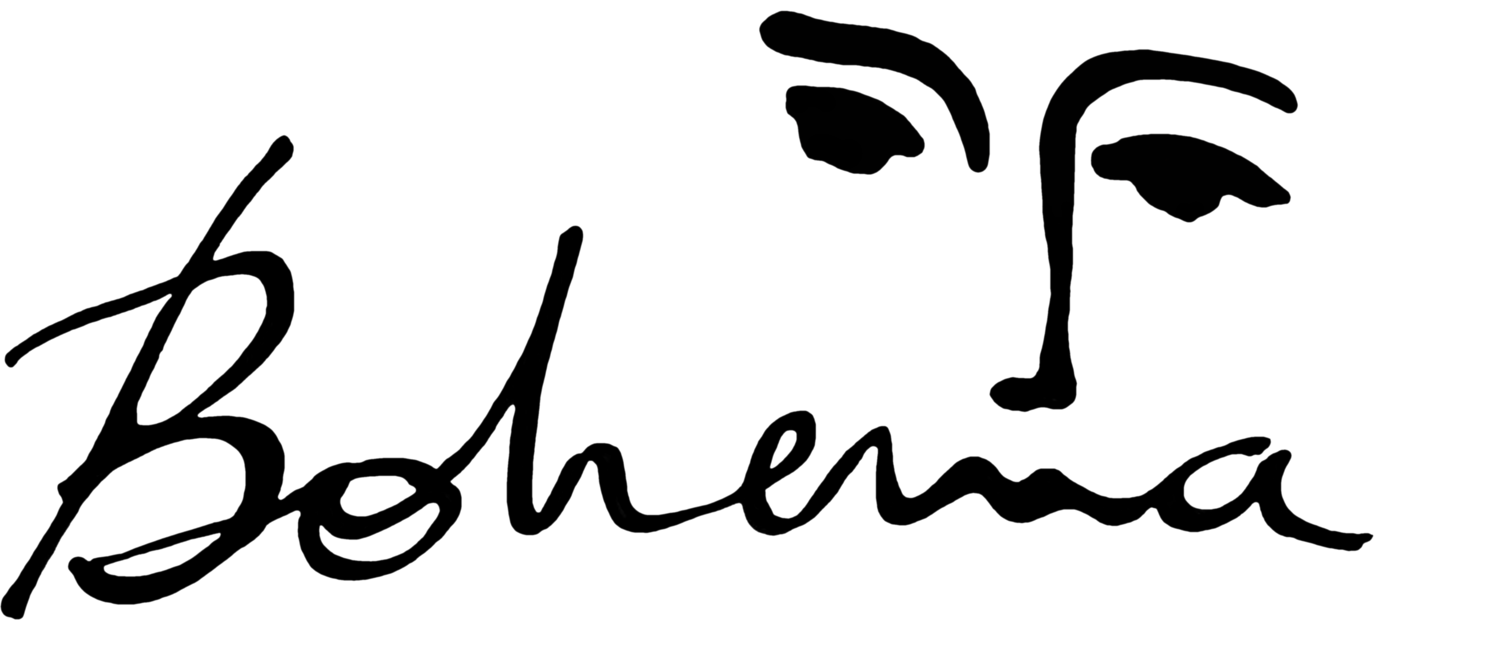Staatsoper vs Theater an der Wien
The opera war is on: Zweimal Norma am selben Tag, einmal kitschig ohne Regiekonzept, einmal tiefgründig-politisch. Kleines Haus, große Kunst! Großes Haus, kleine Stimmen?
Packendes Schauspiel am TAW /// Monika Rittershaus, TAW ©
Die drei Berliner Opernhäuser sind zur Spielplanabsprache verpflichtet, um Mehrfachpremieren des gleichen Werks innerhalb einer Saison zu verhindern. In Wien gilt diese Regel anscheinend nicht, so feiern innerhalb nur einer Woche zwei verschiedene Inszenierungen von Vincenzo Bellinis Norma an der Staatsoper und am Theater an der Wien Premiere. Die Handlung von Norma folgt einer operntypischen Dreieckskonstellation: Die gallische Priesterin Norma (Sopran) hat zwei Kinder mit ihrem politischen Feind, dem römischen Besatzer Pollione (Tenor). Als dieser sich aus Liebe zur jüngeren Gallierin Adalgisa (Mezzosopran) von Norma abwendet (da hat sich bei den Männern in 2000 Jahren nicht viel getan…), entspinnt sich eine persönliche und politische Tragödie.
Wer glaubt, das Theater an der Wien könne mit der prestigeträchtigeren Staatsoper nicht mithalten, wird bereits beim Blick auf die Besetzungsliste überrascht. Die Künstler*innen, die im kleineren Haus auf der Bühne stehen, sind nicht weniger namhaft. Während Publikumsliebling Juan Diego Flórez an der Staatsoper als Pollione auftritt, gibt Starsopranistin Asmik Grigorian am Theater an der Wien ihr Debüt in der Titelpartie. Die Staatsoper lädt U27-Publikum zu ihren vormittags stattfindenden Generalproben ein. Dadurch gab es letzten Mittwoch die einzigartige Gelegenheit, beide Neuinszenierungen am selben Tag zu erleben.
19. Februar 2025, 11 Uhr, Wiener Staatsoper, Generalprobe Norma
First things first: Die Wiener Philharmoniker sind das beste Opernorchester der Welt. Bereits in der Ouvertüre entfesselt Dirigent Michele Mariotti mit scharfen, exakt gesetzten Akzentuierungen eine enorme dramatische Wirkung. Die Philharmoniker spielen die gesamte Generalprobe hindurch mit einer Perfektion, wie sie sonst nur von Konzertorchestern erreicht wird – als Opernorchester sind sie konkurrenzlos.
Bühnenbildnerin Valérie Grall hat die Ruine einer großen Halle auf die Bühne der Staatsoper bauen lassen. Sie dient den Galliern als Kriegslazarett. Die Kostüme von Marie La Rocca verorten die Handlung im Zweiten Weltkrieg. Regisseur Cyril Teste, bekannt für den Einsatz von Live-Videos in seinen Inszenierungen, lässt die Gesichter der Darsteller*innen in emotionalen Momenten auf große Leinwände projizieren – etwa wenn Norma erwägt, ihre Kinder zu töten. In Kombination mit der unangenehm schön anzusehenden Ruine und dem romantischen Wald, der zeitweise auf die Leinwände projiziert wird, wird hart an der Grenze zum Kitsch gekratzt. Die Ästhetisierung des Leidens findet ungebrochen statt. Die Idee, Duftkarten des Parfümeurs Francis Kurkdjian ins Programmheft zu integrieren, um den projizierten Wald olfaktorisch erfahrbar zu machen, ist irgendwie witzig, kann das Fehlen eines spannenden Regiekonzepts aber nicht kaschieren.
Hart an der Grenze zum Kitsch /// Michael Pöhn, Wiener Staatsoper ©
Von den drei Protagonist*innen kann in der Generalprobe nur Vasilisa Berzhanskaya als Adalgisa komplett überzeugen. Juan Diego Flórez als Pollione und Federica Lombardi als Norma spielen zwar in den sanften Passagen und eleganten Koloraturen ihre stimmlichen Stärken aus, gerade in den Höhen und dramatischen Szenen klingt die Stimme von Flórez jedoch dünn und Lombardi unangenehm spitz. Zudem wirkt das Spiel hölzern, sodass die emotionale Entwicklung der Figuren weder stimmlich noch darstellerisch wirklich erfahrbar wird. Für den mittlerweile 52-jährigen Flórez muss Dirigent Mariotti die Lautstärke des Orchesters immer wieder zurücknehmen, damit er überhaupt noch zu hören ist. Sind diese Mängel damit zu begründen, dass die Sänger*innen sich ihre Energie in der Generalprobe bewusst bis zur Premiere aufsparen?
Gleicher Tag, 19 Uhr, Theater an der Wien, 2. Vorstellung Norma
Auf der Bühne des Theaters an der Wien findet das Publikum ebenfalls eine große Halle vor, diesmal von Zinovy Margolin gestaltet. Auch hier wird die Handlung durch die Kostüme von Olga Shaishmelashvili in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lokalisiert. Doch statt eines kriegszerstörten Lazaretts zeigt die Inszenierung eine Fabrikhalle, in der einst Heiligenstatuen gefertigt wurden. Nach dem Umsturz in ein totalitäres Regime werden Norma und die anderen Arbeiter*innen gezwungen, hier die Herrscherbüsten der neuen Machthaber herzustellen. Regisseur Vasily Barkhatov lässt das Stück nicht während einer Besatzung, sondern nach einem gewaltvollen politischen Machtwechsel spielen. Dieser Kniff erlaubt eine tiefere Auseinandersetzung mit innergesellschaftlichen Konflikten. Zusammen mit der Symbolik der verschiedenen Statuen gelingt es, die Verstrickung von Politik, Emotionen, Macht und Religion klug und anschaulich auf die Bühne zu bringen. Das ist wesentlich tiefgründiger als das softe Leiden, das in der Staatsoper im Vordergrund steht.
Chor und Solist*innen zeigen eine auf Opernbühnen leider selten gesehene Spielfreude. Allen voran Asmik Grigorian, die mit wandlungsfähiger, expressiver Stimme und intensivem Spiel Normas innere und äußere Kämpfe aufwühlend verkörpert. Ihre Norma brennt vor Rache – eine Emotion, die in der weichgezeichneten Staatsopern-Inszenierung sehr kurz kommt. Aigul Akhmetshina beweist als Adalgisa mit warmer, dunkler Stimme, dass sie zu den Besten ihres Fachs gehört. Freddie De Tommaso hat sich in den letzten Jahren (u.a. an der Wiener Staatsoper) einen Namen als einer der angesagtesten Tenöre seiner Generation gemacht. Nachdem ihm in seiner ersten Arie einige Töne wegzubrechen drohen, erlangt er im Lauf des Abends seine gewohnte Sicherheit zurück und zeichnet ein sängerisch wie darstellerisch vielschichtiges Porträt des toxischen, macht- und frauenbesessenen Mannes Pollione.
Die großartige Asmik Grigorian /// Monika Rittershaus, TAW ©
Genau so wie es ungerechtfertigt ist, die Leistung der Sänger*innen in der Staatsoper in der Generalprobe zu messen, ist es unfair, ein Orchester mit den Wiener Philharmonikern zu vergleichen. Die Wiener Symphoniker klingen nicht so exakt wie die Philharmoniker, aber gerade ihr beherztes, mitunter schroffes Musizieren wirkt umso intensiver und unterstützt das turbulente Bühnengeschehen. Dirigent Francesco Lanzillotta hat im Vergleich zu seinem Kollegen an der Staatsoper zwei Vorteile: zum einen scheint der kleinere Saal des Theaters an der Wien für Bellinis Musik besser geeignet zu sein, zum anderen muss Lanzillotta die Lautstärke des Orchester zugunsten der Sänger*innen nicht künstlich zurücknehmen.
Fazit: Orchestrale Perfektion vs packendes Musiktheater
Liebhaber*innen des perfektionistischen Musizierens werden weiterhin in die Staatsoper pilgern. Wer fesselndes Musiktheater erleben möchte, findet es im Theater an der Wien. Barkhatovs Regiekonzept ist nicht nur klarer und interessanter, sondern auch in seiner Umsetzung dynamischer und spannender. Im direkten Vergleich mit der Abendvorstellung ist die Generalprobe uninspiriertes Stehtheater zum Weiterschlafen. Das Theater an der Wien triumphiert mit fantastischen Gesangsdarsteller*innen. Ob die große Staatsoper „kleine Stimmen“ engagiert hat, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden und obliegt dem Urteil des Premierenpublikums. Am Ende der Vorstellung im Theater an der Wien gibt es viel Bravo und stehende Ovationen. Das wird die Staatsoper bei ihrer Premiere am Samstag kaum überbieten können.
PS: Alle, die noch Gründe brauchen, zumindest eine der beiden Inszenierungen anzuschauen, mögen den größten Hit aus der Oper anhören: